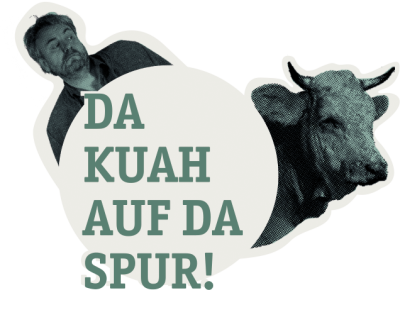Pinzgauer: die „Bergziegen“ unter den Rinderrassen. Familie Wegscheider vom Lacklehen in der Ramsau – eines der 1.600 Mitglieder der Molkereigenossenschaft Berchtesgadener Land – hält schon seit Jahrzehnten auch Pinzgauer Rinder in der Herde. Die kastanienbraune Färbung mit der charakteristischen Rücken- und Bauchblässe ist einzigartig. Die wachsgelben Hörner haben schwarze Spitzen.
Pinzgauer Rinder stammen, wie der Name schon sagt, aus dem benachbarten österreichischem Pinzgau. Früher in den Ostalpen weit verbreitet, wird die Rasse heute auf der Roten Liste der aussterbenden Rassen geführt.
Es ist eine klassische Zweinutzungsrasse für Milch und Fleisch. Die Tiere sind relativ klein, leicht und dementsprechend beweglicher. Und sie sind bezüglich des Futters viel genügsamer, benötigen weniger Energie im Futter. Durch ihr geringeres Gesamtgewicht verursachen sie weniger Trittschäden auf den Almwiesen, die sich in der kurzen Vegetationsperiode in den Bergen immer nur langsam davon erholen können.
Fleckvieh: Rund 98 Prozent der Rinder im Einzugsgebiet der Molkerei Berchtesgadener Land gehören der Rasse Fleckvieh an, so wie die meisten Kühe rund um Berchtesgaden. Du erkennst Fleckvieh an der typischen hellbraunen (auch hellgelben bis dunkelrote) Farbe auf weißem Grund mit einer variationsreichen Scheckung. Der Kopf ist bei diesen stolzen Tieren meist weiß. Fleckvieh zählt als klassische Zweinutztierrasse. Die Kühe geben Milch, die männliche Kälber liefern wertvolles Fleisch.
Die Rasse stammt ursprünglich aus dem Schweizer Simmental und kam vor ca. 180 Jahren aus der Schweiz ins Tegernseer Tal. Diese Kühe waren etwas größer als z. B. die Pinzgauer Rinder, Murnau-Werdenfelser oder das Allgäuer Braunvieh und gaben zudem mehr Milch – der Ursprung der Züchtung des Deutschen Fleckviehs, wie die Rasse heute heißt. Zusätzlich spielen bei der Züchtung Eigenschaften wie Fitness, Gesundheit und z.B. Robustheit der Tiere eine wichtige Rolle. Schnell hatte sich die gute Milch- und Fleischqualität herumgesprochen und weitere Landwirt:innen wollten Tiere der Rasse haben.
Die Landwirt:innen der Molkerei Berchtesgadener Land setzen zu rund 98 % auf das Fleckvieh. Durchschnittlich geben diese Kühe bei traditioneller, für Rinder typischen Fütterung mit Gras (frisch bzw. haltbar gemacht als Heu und Silage) als Grundfutter rund 6.000 bis 7.500 Liter Milch im Jahr.