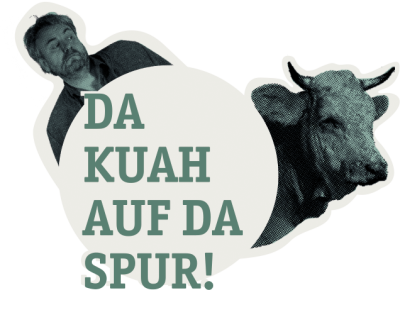Almen sind durch Beweidung entstandene, offen gehaltene Weideflächen – meist in der Waldzonierung der Berge. Es sind von Bauern:Bäuerinnen geschaffene Naturräume. Ohne Auftrieb z.B. von Kühen würden diese Flächen in wenigen Jahren verbuschen und schließlich wieder zu Waldflächen werden. Die besonders artenreiche Flora und Fauna würde verschwinden.
Alpine Milchkrautweiden enthalten als charakteristische Pflanzenarten z.B. Weißklee, Alpen-Rispengras, Alpenlieschgras, Frauenmantel, Alpen-Mutterwurz, Braunklee und viele mehr. Die Gräser, Kräuter und Almblumen sind zum einen wertvolles und vielfältiges Futter für die Kühe und haben direkte Auswirkungen auf die Inhaltsstoffe der Milch. Sie ist besonders reich an Omega-3-Fettsäuren, wichtig für Herzfunktion und Kreislauf beim Menschen.
Hintergrund: Milch von Kühen, die überwiegend Gras und wenig Mais und Kraftfutter fressen, weisen erhöhte Gehalte an mehrfach ungesättigten und konjugierten Fettsäuren auf.
Zum anderen sind diese artenreichen Milchkrautweiden Lebensraum für Insekten, Bienen und Schmetterlinge. Diese offenen Weiden sind idealer Lebensraum für Murmeltiere, die wiederum beliebte Beutetieren von Greifvögeln wie Adler und Co. sind, die allesamt im Berchtesgadener Land heimisch sind.
Das Milchgeld ist für Bergbauern eine wichtige regelmäßige Einkommensquelle. Die Milcherfassung durch die Molkerei Berchtesgadener Land in dieser kleinstrukturierten Bergregion trägt daher wesentlich zum Erhalt der Almflächen und damit indirekt auch zum Erhalt der Biodiversität der Flächen bei.